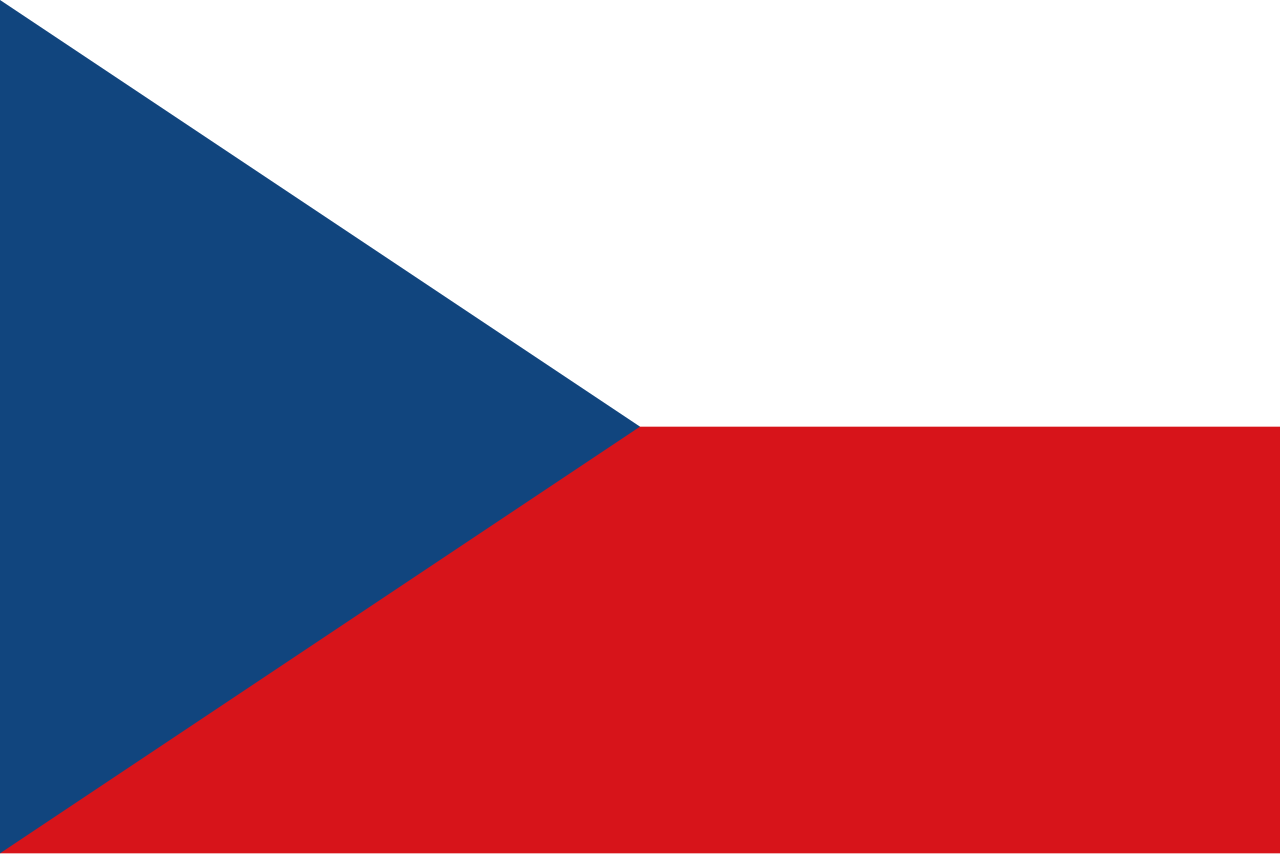Ein lauer Abend in Paris bildete den Hintergrund für “An AI Night in Paris”, Noxtuas erster exklusiver Diskussionsrunde. Ein kleiner Kreis an Vordenkerinnen und Expertinnen widmete sich einer der entscheidenden Frage Europas: Wie kann Souveränität in einem von KI geprägten Zeitalter gesichert werden?
Joséphine Mansour (CEO Noxtua France) führte durch den Abend und brachte eine Reihe namhafter Redner zusammen: Guillaume Decorzent (DG Direction générale des entreprises), Théo Patrier Delunsch (Chief Operations & Transformation Officer, Pluxee), Dr. Leif-Nissen Lundbæk (CEO & Co-Founder, Noxtua), Emmanuel Ronco (Partner, Herbert Smith Freehills Kramer LLP) und Olivier Chaduteau, PhD (CEO & Co-Founder, DayTwo). Die Panelisten beleuchteten dabei die Transformation des Rechtssektors durch KI sowie Fragen der Souveränität, Regulierung, Finanzierung und beruflichen Verantwortung.
Das Ergebnis war mehr als nur eine weitere Panel-Diskussion über Technologie; es war eine nüchterne Reflexion über die Fähigkeit Europas, in einer von KI geprägten Zukunft unabhängig, ethisch und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mehr als nur „Hosting in Europa”: Die Bedeutung wahrer Souveränität
Ein Punkt, auf den sich die Diskutanten einigen konnten: Souveränität wird oft missverstanden. Das Hosting von Daten in Europa auf einer Cloud-Infrastruktur, die einem US-amerikanischen Hyperscaler gehört, macht ein System nicht souverän; selbst wenn dies auf den ersten Blick so erscheint. Denn wahre digitale Souveränität bedeutet Kontrolle – über Standards, Infrastruktur, Daten und ethische Rahmenbedingungen.
Oder wie ein Panelist es prägnant zusammenfasste „Unternehmen in Kalifornien sollten nicht darüber entscheiden, welche Definitionen wir in Europa verwenden.“ Diese Aussage brachte die subtile, aber wesentliche Tatsache zum Ausdruck, dass KI-Lösungen für den Rechtsbereich nicht nur rein geographisch in Europa angesiedelt sein sollten, sondern auch unter europäischer Kontrolle stehen sollten. Ohne diese Unabhängigkeit sind Vertraulichkeit und Vertrauen – die Grundpfeiler der Rechtspraxis – gefährdet.
Regulierung: Die Balance zwischen Vertrauen und Innovation
Das duale Rahmenwerk Europas – die DSGVO und das KI-Gesetz – verkörpert die Bemühungen des Kontinents, eine sichere, auf Rechten basierende Nutzung von Technologie zu definieren. Die DSGVO betont dabei die individuelle Kontrolle über persönliche Daten, während das KI-Gesetz ein risikobasiertes Klassifizierungssystem einführt.
Grundsätzlich konnten sich alle Panelisten darauf einigen, dass die richtige Balance ausschlaggebend ist. Überregulierung droht Innovationen zu bremsen, während Unterregulierung das Vertrauen untergraben kann. Eine solide Regulierung ist die Grundlage für ein vertrauenswürdiges Ökosystem, oder wie ein Diskussionsteilnehmer etwas humoristisch bemerkte: „Der AI Act ist nicht nur dazu da, um Unternehmen zu ärgern – er hat tatsächlich einen tieferen Sinn.“
Finanzierung und Aufbau europäischer KI-Champions
Unabhängig davon, wie streng die Regulierung auch sein mag, ohne ausreichend finanzielle Unterstützung kann die technologische Souveränität Europas nicht gedeihen. Leider erschweren nach wie vor fragmentierte Kapitalmärkte und komplexe Beschaffungssysteme vor das Wachstum europäischer KI-Unternehmen. Ohne die Beseitigung struktureller finanzieller Beschränkungen läuft Europa allerdings Gefahr, sich selbst im Weg zu stehen und so eher zum Konsumenten als zum Entwickler der Technologien zu werden, die unser aller Zukunft bestimmen werden.
In Anlehnung an den Erfolg von Airbus als Symbol für europäische Zusammenarbeit forderte Dr. Leif-Nissen Lundbæk deshalb einen kollektiven neuen „AIrbus-Moment” für Legal AI, also eine grenzüberschreitende strategische Zusammenarbeit, um europäische Champions zu schaffen, die weltweit wettbewerbsfähig sind.
Kultur, Berufsethik und der menschliche Faktor
Digitale Souveränität hängt aber nicht nur von harten technischen Fakten, sondern auch von weichen Faktoren wie Kulturfragen und beruflicher Integrität ab. So wie die DSGVO dazu beigetragen hat, das Thema Datenschutz in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, müssen auch die Sicherheit und Transparenz von KI zu öffentlichen Prioritäten werden. Insbesondere die Rechtsberufe tragen hierbei eine erhöhte Verantwortung: Anwält*innen sind die Hüter der Vertraulichkeit und müssen sicherstellen, dass KI-Tools niemals das Vertrauen ihrer Mandanten gefährden.
Rechtsexpert*innen bleiben dabei für die Entscheidungen und Urteile verantwortlich, die von KI beeinflusst werden. In diesem Sinne geht Souveränität über nationale Grenzen hinaus. Stattdessen liegt es auch in der individuellen Verantwortung angesichts der Automatisierung die berufliche Integrität zu wahren. Oder wie ein Redner warnte: „KI ist wie ein extrem schneller Praktikant – sie muss immer beaufsichtigt werden.”
Souveräne Rechts-KI als Zukunft der Rechtsbranche
„An AI Night in Paris” endete mit einer einheitlichen Vision: Europa muss mit Souveränität vorangehen und darf nicht mit halben Kompromissen folgen. Das erfordert eine Mischung aus Werten, Strategie und Mut:
Souveränität und Vertraulichkeit müssen unverhandelbar bleiben
Eine ausgewogene Regulierung muss Nutzer*innen schützen, ohne den Fortschritt zu behindern
Investitionen und Koordination sind unerlässlich, um europäische Marktführer hervorzubringen
Ethische Verantwortung muss der Grundpfeiler für den KI-Einsatz sein
Zusammenfassend lässt sich sagen: KI verändert bereits jetzt den Rechtsberuf. Und ob Europa diese Transformation gestaltet oder sich den Regeln anderer anpasst, hängt von einer entscheidenden Entscheidung ab – wie viel Souveränität wir alle bereit sind, einzufordern.