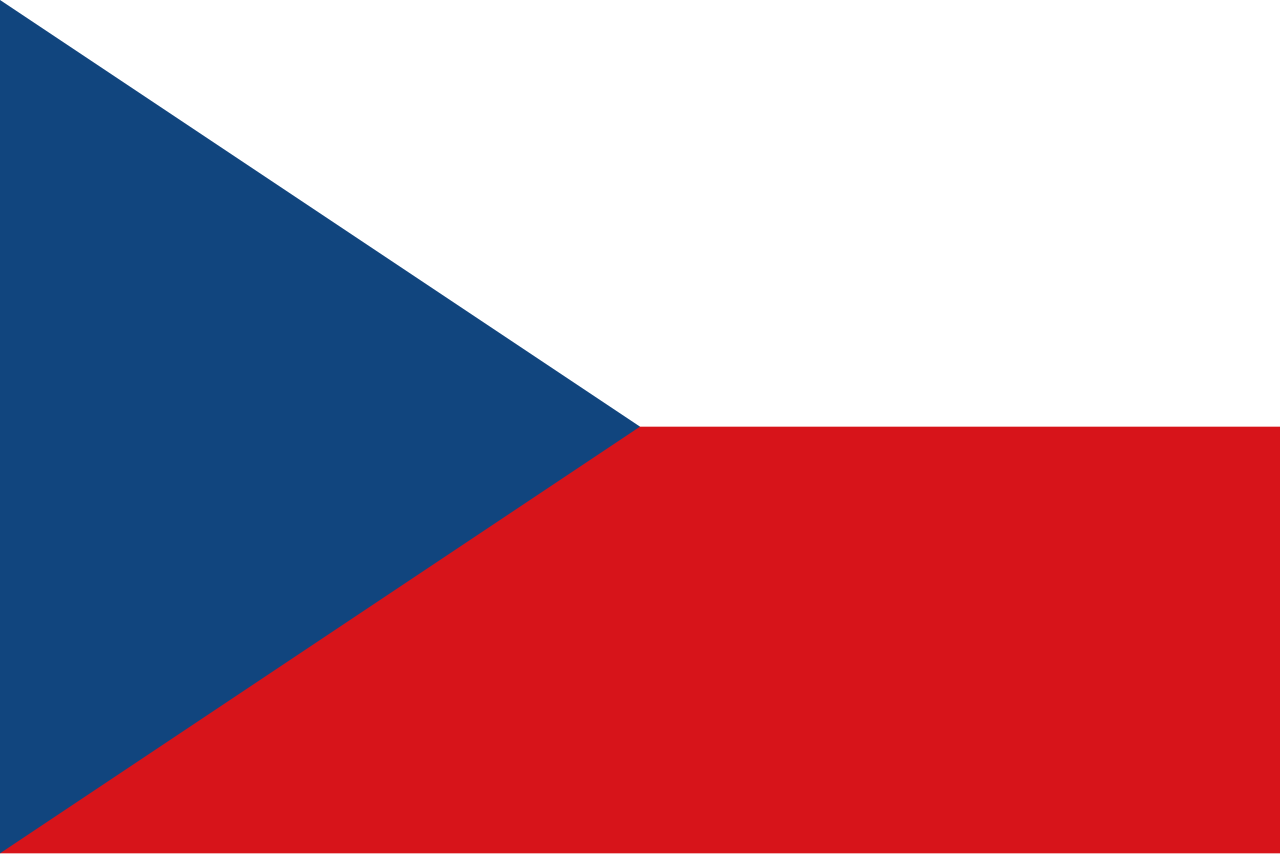Künstliche Intelligenz revolutioniert die Rechtswelt. Doch die Zusammenarbeit mit der KI will gelernt sein. Das sogenannte Prompten, die ausformulierte Anweisung, die Sie der KI geben, entscheidet maßgeblich über die Qualität des Ergebnisses. Vor allem spezialisierte Rechts-KI-Systeme können Ihre juristische Arbeit mithilfe gezieltem Prompt Engineering erheblich erleichtern.
Basierend auf hunderten Stunden praktischer Arbeit mit zahlreichen Rechts-KI-Systemen, erfahren Sie in diesem Artikel, welche Prompt-Techniken zu den besten Ergebnissen führen, wie Sie typische Fallstricke vermeiden und Ihre juristische Arbeit nachhaltig effizienter gestalten.
Was ist Legal Prompting?
Als Legal Prompting bezeichnet man die formulierte juristische Aufgabe, die Sie der KI stellen. Je präziser Ihr Prompt formuliert ist, desto besser werden die Ergebnisse der KI. Denn ein wohlformulierter Prompt funktioniert wie ein gut strukturierter Schriftsatz: Er lenkt das „Denken" der KI in die gewünschten Bahnen, definiert den rechtlichen Rahmen und stellt sicher, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Der entscheidende Unterschied zu menschlichen Gesprächspartnern liegt darin, dass KI-Systeme stärker auf die Qualität und Präzision Ihrer Anweisungen angewiesen sind.
Mithilfe von Prompt Engineering, also der Entwicklung von effektiven Prompts, betrachten wir Struktur, Sprache und Informationsgehalt des Prompts, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Die wesentlichen Komponenten eines Prompts
Um einen juristischen Prompt zu entwickeln, der zu hochwertigen Ergebnissen führt, sollte dieser einer klaren Architektur folgen. Die folgenden sechs Komponenten haben sich in der Praxis bewährt und dienen als Orientierung, Ihren Prompt systematisch und effektiv aufzubauen.
1. Anweisungen – Das Herzstück Ihres Prompts
Die Anweisung definiert, welche Aufgabe die KI ausführen soll. Juristische Prompts unterscheiden sich dabei fundamental von alltäglichen KI-Anfragen, da der rechtliche Kontext so präzise wie möglich beschrieben werden sollte. Beispielsweise „Analysiere die Kündigungsschutzklage gegen eine betriebsbedingte Kündigung und bewerte die Erfolgsaussichten unter Berücksichtigung der aktuellen BAG-Rechtsprechung."
2. Kontext – Den rechtlichen Rahmen definieren
Hier fügen Sie alle relevanten Hintergrundinformationen ein, die berücksichtigt werden sollen, wie z.B. Gesetzestexte, Vertragsdokumente, Sachverhalte oder spezifische Urteile. Mit diesen Informationen definieren Sie den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die KI arbeiten soll.
3. Rolle – Die juristische Expertise definieren
Die Formulierung „Agiere als erfahrener Fachanwalt für Steuerrecht mit 15 Jahren Praxiserfahrung" bewirkt, dass die KI ihre Antworten auf entsprechend hohem Fachlichkeitsniveau formuliert. Sie können die Rolle auch situativ anpassen: „Nimm die Perspektive eines kritischen Richters ein" führt zu anderen Analysen als „Argumentiere aus Sicht des Anwalts der Gegenseite."
4. Zielgruppe – Für wen wird formuliert?
Die Beschreibung Ihrer Zielgruppe beeinflusst den Sprachstil und die Fachlichkeit der KI-Antwort. Besonders wirkungsvoll ist: „Nimm an, ich bin ein Mandant ohne juristische Vorerfahrung, der aber intelligent genug ist, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen, wenn sie gut erklärt werden."
5. Format – Struktur und Umfang definieren
Konkrete Formatangaben wie „Gliedere deine Antwort in drei Abschnitte mit jeweils maximal 200 Wörtern" oder „Erstelle eine Tabelle mit Spalten für Rechtsproblem, Rechtsgrundlage und Lösungsansatz" helfen der KI dabei, strukturierte und übersichtliche Antworten zu präsentieren.
6. Ton und Formulierung – Die sprachliche Ebene
Die Wahl des Tons beeinflusst nicht nur die Lesbarkeit, sondern auch die Überzeugungskraft. „Formuliere sachlich und neutral für eine Stellungnahme" führt zu anderen Ergebnissen als „Argumentiere überzeugend und durchsetzungsstark für eine Verhandlung."

Die 10 wichtigsten Prompting-Strategien für Jurist*innen
Neben den oben genannten Bausteinen, die die Struktur Ihres Prompts bestimmen, gibt es einige grundlegende Tipps, wie Sie juristische Prompts optimal formulieren. Hier sind die zehn wichtigsten Prompting-Tipps für Jurist*innen.
1. Präzision schlägt Höflichkeit
Formulieren Sie prägnant und präzise – dabei können Sie auf umständliche und zu höfliche Ansprachen verzichten. Formulierungen wie „Könntest du vielleicht..." verwässern Ihre Anweisung und können zu unklaren Ergebnissen führen. Formulieren Sie stattdessen direkt: „Analysiere die Haftungsklausel in § 12 des beigefügten Vertrags auf ihre Wirksamkeit nach AGB-Recht. Berücksichtige dabei die aktuelle BGH-Rechtsprechung zu Haftungsausschlüssen im B2B-Bereich."
2. Die Macht positiver Formulierungen nutzen
KI-Systeme wie auch Menschen verarbeiten positive Anweisungen effizienter als negative. Statt „Ignoriere nicht die aktuellen Gesetzesänderungen" formulieren Sie „Berücksichtige die aktuellen Gesetzesänderungen seit Januar 2024." Die positive Formulierung führt die KI direkter zu den gewünschten Informationen.
3. Schrittweise Denkprozesse fördern
Die Anweisung „Gehe Schritt für Schritt vor und lasse dir Zeit für jeden Analyseschritt" aktiviert in KI-Systemen einen strukturierteren Denkprozess. Sie „zwingt" das Modell dazu, Zwischenschritte zu durchdenken, anstatt direkt zur Schlussfolgerung zu springen – in juristischen Kontexten bedeutet dies eine systematische Prüfung von Sachverhalt, Rechtslage und Bewertung.
4. Quellenangaben als Qualitätsgarantie einfordern
Die explizite Anweisung „Nenne für jede rechtliche Aussage die konkrete Rechtsgrundlage, das relevante Urteil oder die entsprechende Literaturstelle" verbessert nicht nur die Nachprüfbarkeit, sondern auch die Qualität der KI-Antworten. Zusätzlich können Sie auch Formatierungsanforderungen vorgeben, wie „Strukturiere deine Antwort so, dass jede rechtliche Aussage von einer Quellenangabe gefolgt wird."
5. Unsicherheit produktiv nutzen
Die Anweisung „Wenn du dir bei einer rechtlichen Aussage nicht vollständig sicher bist, sage dies explizit und erkläre, welche zusätzlichen Informationen für eine sichere Bewertung nötig wären", verwandelt die KI-Schwäche der Halluzinationen in eine Stärke. Sie erhalten ehrliche Kommunikation über Wissensgrenzen und Hinweise auf erforderliche zusätzliche Recherchen.
6. Strukturierung durch bewusste Formatierung
Nutzen Sie Satzzeichen, Zeilenumbrüche und Strukturierungselemente als aktive Steuerungsinstrumente. Ein gut strukturierter Prompt, wie der folgende, führt zu besser strukturierten und verwertbaren Antworten:
AUFGABE: Bewertung der Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage
SACHVERHALT: [Detaillierte Beschreibung]
RECHTLICHE PRÜFUNGSPUNKTE:
1. Zulässigkeit: [Auflistung der Voraussetzungen]
2. Begründetheit: [Auflistung der Voraussetzungen]
FORMAT: Für jeden Prüfungspunkt eine ausführliche rechtliche Analyse in mindestens drei Sätzen.
7. Few-Shot Prompting: Mit Beispielen führen
Wenn Sie ein bis drei konkrete Beispiele für das gewünschte Format voranstellen, verbessert sich die Qualität erheblich. Für Vertragsklausel-Analysen kann dies beispielsweise so aussehen:
Analysiere die Vertragsklausel nach folgendem Muster:
KLAUSEL: [Wortlaut]
ANFORDERUNG: [Anforderung]
BEWERTUNG: [Unwirksam/Bedenklich/Unbedenklich]
BEGRÜNDUNG: [2-3 Sätze]
8. Juristische Fachsprache als Präzisionsinstrument
Verwenden Sie bewusst exakte Rechtstermini: „Prüfe die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO insbesondere im Hinblick auf die berechtigten Interessen" gemäß lit. f.”, ist präziser als „Schaue, ob die Datennutzung legal ist." Die Fachsprache hilft spezialisierten Rechts-KI-Systemen dabei, die entsprechenden Rechtsbereiche zu identifizieren und in mit präzisen Formulierungen zu antworten.
9. Perspektivwechsel als Analyseinstrument
„Analysiere den Fall zunächst aus Sicht der Klägerin, dann aus Sicht der Beklagten, und bewerte anschließend aus neutraler Richterperspektive die Erfolgsaussichten beider Seiten" führt zu ausgewogeneren und durchdachteren Analysen. Diese Multi-Perspektiv-Analyse hilft dabei, Schwachstellen in der eigenen Argumentation zu identifizieren.
10. Iterative Verfeinerung als Erfolgsstrategie
Beginnen Sie mit einfacheren Prompts und verfeinern Sie diese basierend auf den Ergebnissen. Starten Sie mit einer grundlegenden Anfrage, analysieren Sie die Antwort und formulieren Sie dann eine verfeinerte Folgefrage: „Deine Analyse zu Punkt 2 war hilfreich. Vertiefe nun bitte die Argumentation zur Sozialauswahl und berücksichtige dabei die BAG-Rechtsprechung zu den Voraussetzungen in § 1 Abs. 3 KSchG."

Mehrstufiges Prompting für komplexe Aufgaben
Sollten Sie vor komplexen rechtlichen Aufgaben stehen, die in strukturierte, aufeinander aufbauende Schritte zerlegt werden sollten, erreichen Sie mit mehrstufigen Prompts bessere und nachvollziehbare Ergebnisse. Hierbei gibt es verschiedene Methoden, die Sie nach Bedarf wählen können.
Multi-Step Prompting: Die Kette einzelner Aufgaben
Teilen Sie eine komplexere Analyse in logisch aufeinanderfolgende Einzelschritte auf und weisen Sie die KI schrittweise an. Hier ein praktisches Beispiel für eine Vertragsanalyse:
Schritt 1: „Lies die nachfolgende Liste von Prüfungspunkten durch und extrahiere alle jeweils einschlägigen Klauseln aus dem beigefügten Vertragsdokument."
Schritt 2: „Gehe die Prüfungspunkte nacheinander durch und prüfe jeweils, ob die extrahierte Klausel den rechtlichen Anforderungen aus dem Prüfungspunkt entspricht."
Schritt 3: „Erstelle eine Tabelle, in der die Ergebnisse der Prüfung dargestellt sind. Die Tabelle soll folgende Spalten enthalten: Prüfungspunkt | Klausel | Bewertung"
Der Vorteil: Das Ergebnis eines jeden Schritts kann einzeln von Ihnen überprüft und korrigiert werden, bevor der nächste Schritt auf diesem Resultat aufbaut.
Chain-of-Thought: Der durchdachte Gedankengang
Wenn Sie volle Nachvollziehbarkeit über das Resultat der KI benötigen, können Sie diese instruieren, ihren kompletten Lösungsfindungsweg offenzulegen. Ein Beispiel für einen solchen Prompt würde lauten:
Prüfe den Inhalt der beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen strukturiert anhand folgenden Schemas:
Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309 BGB)Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit (§ 308 BGB)Transparenzgebot (§ 307 I 2 BGB)Generalklausel (§ 307 I 1 BGB)
Füge für jeden Prüfungspunkt eine ausführliche Erklärung bei unter Bezugnahme auf die genannten Normen.
Reverse Prompting: Vom Ziel zum Weg
Sie wissen genau, wie das Endergebnis aussehen soll, Ihnen fehlt aber der entsprechende Prompt? Mit Reverse Prompting drehen Sie die klassische Logik des Promptings um: Statt der KI eine Anweisung zu geben und ein Ergebnis zu erhalten (Prompt → Output), funktioniert es umgekehrt (Output → Prompt). Sie geben also ein gewünschtes Ergebnis vor – zum Beispiel einen Text oder eine Klausel – und lassen sich von der KI den Prompt erzeugen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit genau zu diesem Ergebnis führen würde. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Ihre eigenen Prompts optimieren und für ähnliche Aufgaben wiederverwenden möchten.
Ein Beispiel könnte so aussehen:
Dies ist eine juristische Klausel zur DSGVO-Einwilligung: [Beispieltext]. Formuliere den Prompt, den ich eingeben müsste, damit du genau dieses Ergebnis erzeugst.
Ihr Weg zum Prompting-Experten
Die Rechtsbranche digitalisiert sich rasant und der Einsatz von KI wird ein fester Bestandteil juristischer Arbeit in Unternehmen, Kanzleien und Behörden. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Legal Prompting zur unverzichtbaren Schlüsselkompetenz für moderne Jurist*innen – eine Fähigkeit, die nicht nur Effizienzsteigerungen ermöglicht, sondern auch die Arbeitsqualität nachhaltig verbessert.
Der entscheidende Erfolgsfaktor liegt darin, juristische Expertise mit KI-Power zu verbinden: Wer lernt, seine fachlichen Kenntnisse durch geschicktes Prompten optimal in die Zusammenarbeit mit spezialisierter Rechts-KI einzubringen, kann das volle Potenzial dieser Technologie und seiner Arbeit ausschöpfen.